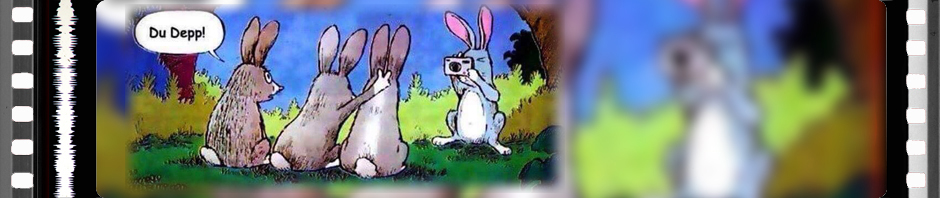Nach diesem Güterzug-Unfall ist alles möglich. Waggons schieben sich in Waggons, sie explodieren, türmen sich zu Bergen aus Metall, sie fliegen, drehen und winden sich. Es dauert eine unglaublich lange Zeit. Überall Feuer und schwere Teile, die sich in den Boden rammen. Es ist eine visuelle Wucht, die den Zuschauer vergessen lässt, was für einen physikalischen Unsinn er vorgesetzt bekommt. Dies ist der Film, den Steven Spielberg so zum Glück nie umgesetzt hätte. Mit dem als Hommage gedachten „Super 8“ schießt Jeffrey Jacob Abrams so weit am Ziel vorbei, wie die Waggons bei ihm hoch fliegen.
Nach diesem Güterzug-Unfall ist alles möglich. Waggons schieben sich in Waggons, sie explodieren, türmen sich zu Bergen aus Metall, sie fliegen, drehen und winden sich. Es dauert eine unglaublich lange Zeit. Überall Feuer und schwere Teile, die sich in den Boden rammen. Es ist eine visuelle Wucht, die den Zuschauer vergessen lässt, was für einen physikalischen Unsinn er vorgesetzt bekommt. Dies ist der Film, den Steven Spielberg so zum Glück nie umgesetzt hätte. Mit dem als Hommage gedachten „Super 8“ schießt Jeffrey Jacob Abrams so weit am Ziel vorbei, wie die Waggons bei ihm hoch fliegen.
Während eine Gruppe Jugendlicher mit den Super-8-Kameras ihrer Eltern einen Zombiefilm drehen, kommt es zu einem folgenschweren Zugunglück. Nur die aufnehmende Kamera sieht, was sich aus den rauchenden Trümmern von der Unfallstelle fort in die Stadt bewegt. Es ist 1979, und belichtetes Super-8-Material braucht mindestens drei Tage, um entwickelt zu werden. Pech für die kleine Stadt Lillian, denn sonst hätten die Jungfilmer wesentlich früher vor dem Schrecken warnen können, der die Stadt in Angst und Schrecken versetzen wird.
Während „Super 8“ auf sich allein gestellt ein super Film wäre, versagt er auf ganzer Linie an seinen eigenen Ansprüchen. Als Regisseur kann Spielberg lediglich mit „Unheimliche Begegnung“ und „E.T.“ Vorbildarbeit geleistet haben, vielleicht noch ein klein wenig mit seinem Segment zu „Twilight Zone: The Movie“. Doch viel mehr bleibt nicht, woraus Abrams schöpfen konnte und was „Super 8“ als daraus resultierende Hommage rechtfertigen würde. Allein schon, dass Spielberg „seine“ Kinder niemals dessen ausgesetzt hätte, was Abrams seinen Darstellern während des Zugunglücks zumutet. Und Lichteinstreuer im Objektiv? Abrams will sich scheinbar ein grundsätzlich übertriebenes und ebenso grundsätzlich nervendes Markenzeichen setzen. Hätte er seinen Meister besser studiert, hätte er schnell erkannt, dass Spielbergs Kameramann Vilmos Zsigmond bei „Unheimliche Begegnung“ die Spiegelungen in der Optik als handlungsbezogenes Element zur mysteriösen Übersteigerung eingesetzt hat.
Leider wird der Hommage-Anspruch auf die Spielbergschen Ergüsse der 80er-Jahre so aufdringlich und eindringlich in den Kampagnen geführt, dass vollkommen abhanden kommt, dass „Super 8“ ohne diese Attribute wesentlich besser dran wäre. Außer überflüssigen Lichteinstreuern hat Abrams dem Zuschauer auch sehr viele gute Sachen serviert. Das fängt schon mit dem durchweg überzeugenden Ensemble an, bei dem sich besonders die Jungdarsteller als grandiose Wahl hervortun. Mühelos tragen sie den kompletten Film. Mit ihren wunderbaren, niemals aufgesetzten Charakterisierungen werden sie umgehend zum emotionalen Dreh- und Angelpunkt des Zuschauers. Ihre Probleme, ihre Ängste existieren nicht um der Geschichte willen, sondern ehrlich. In der Beziehung zwischen dem schüchternen Helden Joe und dem dominierenden Charles wird der Film tiefgründiger, als man sonst in einem Familienfilm zu erwarten hofft. Dazu ist Kyle Chandlers und Elle Fannings Zusammenspiel schlichtweg elektrisierend. Hier gelingt es dem Autor und gleichzeitigen Regisseur, seinem auserkorenem Vorbild am nächsten zu kommen. Der Zuschauer kümmert sich um die Figuren, er sorgt sich, fiebert und leidet mit ihnen. Heute passiert das eher selten im Kino, und wenn, dann nicht in dieser starken Bindung, wie es Abrams mit „Super 8“ gelingt.
Aber. In den beanspruchten Vorbildern griffen Charakter, Geschichte, Dialog und Aussage scheinbar mühelos ineinander und bildeten ein grandioses Ganzes, das ihnen ihren verdienten Platz in der Geschichte sicherte. Abrams bekommt seine Figuren und die eigentliche Geschichte nicht zusammen. Ein Alien terrorisiert die Stadt, und diese Storyline verliert zunehmend an Aufmerksamkeit. Der Zuschauer will bei den Kindern bleiben, ist viel mehr an ihren emotionalen Höhen und Tiefen interessiert, ist von ihnen so vereinnahmt, dass die Hatz nach dem Außerirdischen eher zum lästigen Beiwerk verkommt. Das liegt aber auch daran, dass Abrams es sträflich versäumt hat, dem Publikum das Wesen und die Absichten des Monstrums näherzubringen. Erst viel zu spät im Film offenbart sich der eigentliche Kern der Geschichte. Doch da ist längst das Kind in den Brunnen, beziehungsweise in das Alien-Nest gefallen.
Man muss gewillt sein, Abstriche bei den eigenen und besonders bei den Ansprüchen eines J. J. Abrams zu machen, dann ist „Super 8“ ein viel besserer Film. Er ist nicht der Film, den man nach dem ersten Trailer von vor 18 Monaten erwartet hatte. Es ist auch nicht der Film, den die Strategen heute dem Publikum versprechen. Er will das Flair der 80er-Jahre heraufbeschwören. Dadurch, dass Abrams auch alle Register des aktuellen Kinos zieht, kann das Ansinnen höchstens im Ansatz gelingen. Doch macht man einen großen Schritt zurück, ist „Super 8“ ein starker, überzeugender Film. Auch die Geschichte des entflohenen Aliens funktioniert, ist sehr gut umgesetzt und ohne Längen durchaus spannend inszeniert. Und das unabhängig davon, ob sie von den dominierenden Figuren der Kinder unterdrückt wird.
Wenn „Super 8“ keine Akzeptanz findet, haben das Andere zu verantworten, nicht der Film selbst. Er hat eine Chance verdient, weil er durchdachter, tiefgründiger, spannender und ehrlicher ist, als man ihm zuerst zugestehen möchte. Und er durchdachter, tiefgründiger, spannender und ehrlicher ist, als so manch anderer Blockbuster in jüngster Zeit. Außerdem ist es ein sehr witziger Film, manchmal komischer als einer dieser Spielberg-Familienfilme.
 Darsteller: Kyle Chandler, Elle Fanning, Joel Courtney, Gabriel Basso, Noah Emmerich, Ron Eldard, Riley Griffiths, Ryan Lee, Zach Mills und Bruce Greenwood als Cooper
Darsteller: Kyle Chandler, Elle Fanning, Joel Courtney, Gabriel Basso, Noah Emmerich, Ron Eldard, Riley Griffiths, Ryan Lee, Zach Mills und Bruce Greenwood als Cooper
Regie & Drehbuch: Jeffrey Jacob Abrams – Kamera: Larry Fong – Bildschnitt: Maryann Brandon, Mary Jo Markey – Musik: Michael Giacchino – Produktionsdesign: Martin Whist
USA / 2011 – zirka 112 Minuten