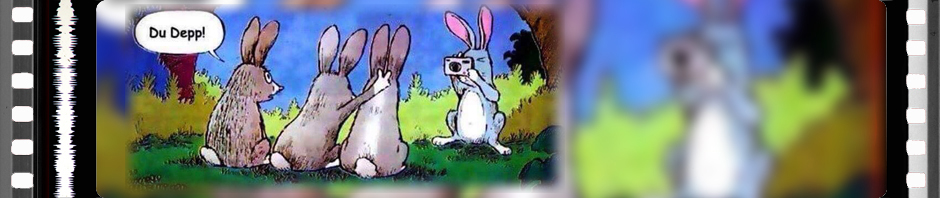Das hat doch etwas. Diese Vorstellung, man könnte erfolgreich durchs Leben gehen, ohne wirklich dafür zu arbeiten, ohne Verpflichtungen zu haben, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Nicht einfach nur durchzuhalten oder an der Grenze entlang zu leben. Nein, wirklich die Kunst – deswegen auch der Titel – die Kunst der Welt glauben zu machen, der persönliche Erfolg wäre darauf begründet, auch etwas dafür getan zu haben. Das hat tatsächlich etwas. Eine Geschichte, wie gemacht für das Kino. Früher hat so etwas Frank Capra gedreht, bis Claudette Colbert dem missverstandenen Gary Cooper endlich den Marsch bläst. Heute ist es Emma Roberts, die bläst, allerdings nur heiße Luft, weil sich als Lebenslügner Freddie Highmore durch einen Film mogelt, der sich selbst als Mogelpackung präsentiert.
Das hat doch etwas. Diese Vorstellung, man könnte erfolgreich durchs Leben gehen, ohne wirklich dafür zu arbeiten, ohne Verpflichtungen zu haben, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Nicht einfach nur durchzuhalten oder an der Grenze entlang zu leben. Nein, wirklich die Kunst – deswegen auch der Titel – die Kunst der Welt glauben zu machen, der persönliche Erfolg wäre darauf begründet, auch etwas dafür getan zu haben. Das hat tatsächlich etwas. Eine Geschichte, wie gemacht für das Kino. Früher hat so etwas Frank Capra gedreht, bis Claudette Colbert dem missverstandenen Gary Cooper endlich den Marsch bläst. Heute ist es Emma Roberts, die bläst, allerdings nur heiße Luft, weil sich als Lebenslügner Freddie Highmore durch einen Film mogelt, der sich selbst als Mogelpackung präsentiert.
Für George Zinavoy ist das Leben eine nicht beeinflussbare Aneinanderreihung von Ereignissen. Man wird alleine geboren, und man stirbt alleine. Warum sich also um oder für etwas bemühen? Dann trifft er die bezaubernde Sally. Und er steht kurz davor, von der Schule suspendiert zu werden. Und er lernt einen Künstler kennen, der ihn nachdenklich stimmt. Und überhaupt. George hat Probleme, und eine romantische Beziehung kommt da nicht sehr gelegen. So, wo liegt die Kunst, sich durchzumogeln?
Tatsächlich liegt das Problem von Gavin Wiesens Drehbuch darin, dass sein Hauptcharakter überhaupt kein Lebenskünstler ist. Er ist einfach nur ein uninspirierter Lügner, einer, der sofort durchschaut wird, ein Charakter, der keinerlei Sympathien zu wecken versteht. Der Film ist eine der unendlichen Varianten einer Figur, die sich am Rande des Erwachsenwerdens bewegt. Die Bemühungen sind spürbar, einen interessanten Film zu machen, der einen Jugendlichen auf der Schwelle zum Erwachsenen zeigt. Emma Roberts als Sally, die selbst mit den Problemen der Jugend zu kämpfen hat, schaut man gerne zu. Sie wirkt natürlich und zeigt dabei einen starken Charakter. Blair Underwood ist souverän zurückhaltend und ebenso sehenswert. Und Alicia Silverstone, wenn auch nur kurz als jungfräuliche Lehrerin, die bebrillt und mit Wolljacke gekleidet durch den Klassenraum huscht. Das will man sehen.
Aber da ist eben George Zinavoy, ein Charakter, der seiner Umwelt nichts gibt, dem seine Mitmenschen egal sind, der einfach nur ein Arschloch ist. George hat einfach keine guten Eigenschaften und deshalb will man mit diesem Menschen auch nichts zu tun haben. Er interessiert nicht, man kann ihn höchstens verachten. Und dass man dabei auch noch Freddie Highmore zusehen muss, wie er versucht unsympathisch zu sein, macht es noch eine Spur unerträglicher. Highmore mag als Kinderstar mit großen Augen und verschmitztem Grinsen überzeugt haben, in diesem Film wirkt er allerdings wie das Antonym seines Charakters. Lustlos, desinteressiert, Zeit totschlagend, nervend. Entweder ist Highmore noch nicht so weit, komplexere Rollen auszufüllen, oder Regisseur Gavin Wiesen wusste einfach nichts mit dieser Figur anzufangen.
Wie schön wäre das, und wie gerne würde man dabei zusehen, wenn sich jemand erfolgreich durchs Leben schlägt, ohne die Wege zu gehen, die einem die Gesellschaft vorgibt. Man könnte sich sehr gut Kieran Culkin vorstellen, der mit seiner verschlagenen Art doch so charmant sein kann. Aber nicht wie in „Igby“, sondern eher eine Variation von „Das Leben – Ein Sechserpack“. Das wäre schön, das wäre sogar sehr vergnüglich. Wenn charmante Darsteller charmante Schwindler spielen und dann etwas mitnehmen auf ihren Weg. Wenn sie sich ändern, ohne sich zu verraten. Wenn sie auch dem Zuschauer etwas mitgeben, nicht nur Spaß, sondern ein klein wenig zum Nachdenken vielleicht. Gavin Wiesens Film scheitert allein an seiner eigenen uninspirierten Figur und einem Hauptdarsteller, der alles nur noch schlimmer macht.
Darsteller: Freddie Highmore, Emma Roberts, Michael Angarano, Rita Wilson, Blair Underwood, Alicia Silverstone, Elizabeth Reaser, Sam Robards u.d.
Regie & Drehbuch: Gavin Wiesen
Kamera: Ben Kutchins
Bildschnitt: Mollie Goldstein
Musik: Alec Puro
USA / 2011
zirka 84 Minuten