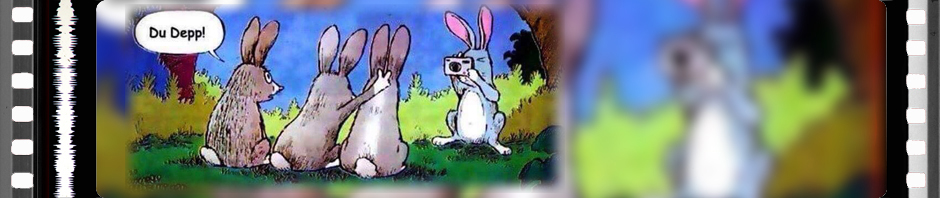THE WALKING DEAD
THE WALKING DEAD
seziert und gespoilert
Was ist der Zombie in unserer Gesellschaft? Dem Zombie fehlt schlichtweg die Aura des Mysteriösen, des Unnahbaren, des Interessanten. Jekyll und Hyde, der Werwolf oder die Katzenmenschen. Sei es Buffy oder alles, was an Vampiren durch die Nacht schleicht. Ein Mensch, erschaffen aus vielen Teilen anderer Menschen. Der Außerirdische, der im Wandschrank wohnt, oder Invasoren aus für uns unvorstellbaren, anderen Welten. Der Zombie ist einfach nur hässlich. Er ist nicht von inneren Dämonen getrieben und er hat auch keine wirklichen Ambitionen. Er riecht schlecht und es wird mit der Zeit auch nicht besser.
Jedes Monster aus Buch, Film und Fernsehen versucht einen phantastischen Bezug zu der inneren Zerrissenheit eines Menschen herzustellen. Der sichere Platz Erde gegen die unerforschten Welten unseres Universums. Der ehrbare Mensch gegen das Ignorieren aller Etiketten. Das biedere Leben gegen die Verdammnis der Nacht und der Unsterblichkeit. Der Zombie hingegen hat nur dein Bestes im Sinn, bietet dabei aber keinerlei Faszination. Er ist nichts weiter als der erhobene Zeigefinger für unsere Sterblichkeit. Und diese Sterblichkeit ist wirklich bitter. Niemand möchte so durch die Welt wandern, zerrissene Kleidung und abfallende Hautfetzen, Mundgeruch und sprödes Haar. Natürlich fragt man sich, wie so ein Phänomen möglich ist, aber das ist es dann auch schon. Der Rest nervt nur, weil sie sich dann auch noch überall herumtreiben. Deswegen werden sie ja auch Walking Dead genannt.
Frank Darabont jedenfalls fragt sich nicht, wie dieses Phänomen möglich ist. Rick Grimes heißt der Deputy Sheriff, der nach dem Erwachen aus dem Koma in die untote Welt gestoßen wird. Es ist die Welt von Robert Kirkman, der mit den Zeichnern Tony Moore und Charlie Adlard den kläglichen Rest der Menschheit der Zombie-Apocalypse aussetzte. Obwohl es sich in den vergangenen Monaten regelrecht aufgedrängt hat, die Comic-Reihe zu lesen oder zumindest anzureißen, wäre jeder Versuch eines Vergleichs sowieso ein sinnloses und absurdes Anliegen. Sind die Comics gut? Wer weiß. Wie stehen die Comics zu der begonnenen Serie? Interessiert das denn? Ist die Serie gut? Der Pilot jedenfalls ist brillant.
Frank Darabont ist dieser geniale Kopf hinter den besten Stephen-King-Verfilmungen SHAWSHANK REDEMPTION und GREEN MILE, aber auch dem zu Unrecht gefloppten THE MAJESTIC. Darabont auf dem Regiesessel bedeutet, dass ein intimes, zwischenmenschliches Drama zum Epos wird, und weltliche Dimensionen auf ein berührendes Kammerspiel heruntergebrochen werden. Darabont ist Schauspieler-Regisseur, der dabei immer das große Ganze zu berücksichtigen versteht. An seine Seite gesellte sich Gale Anne Hurd, dieses zerbrechliche Frauenwesen, das von seiner Produzenten-Position aus Knaller wie ALIENS, TERMINATOR oder ARMAGEDDON zu verantworten hat. Dank des Bezahlsenders HBO und seiner Bereitwilligkeit, gute Programme auch entsprechend finanziell aufzupeppen, haben sich amerikanische Fernsehformate mittlerweile an gehobenes Kinoniveau angenähert. Der Sender AMC hat die Strategie begriffen und mit MAD MEN vor vier Jahren ein Fernseh-Ereignis kreiert.
Frank Darabont war von Anfang an von Kirkmans Comic-Welt THE WALKING DEAD angetan. Schrieb ein Drehbuch für die erste Episode, holte Gale Anne Hurd an seine Seite und wollte das Ganze auch noch produzieren. Und damit auch wirklich niemand nein sagen konnte, bot Darabont an, bei Folge eins auch noch Regie zu führen. Und AMC, mit dem wachsenden Erfolg von MAD MEN gestärkt, griff Anfang des Jahres 2010 begeistert zu. Was folgte, war eine beispiellose Werbe-Kampagne, die mit allem Angriff, was die moderne Kommunikation möglich macht, ausführlicherer Ausschnitt auf der Comic-Con in San Diego inklusive. Mit einem bisher einmaligen Publicity-Stunt geisterten am Tag vor der Sonntagspremiere zeitgleich in sämtlichen Metropolen der Welt Flash-Mob-artig ganze Zombie-Horden durch die Innenstädte.
Frank Darabont fragt sich nicht, wie dieses Phänomen der auferstandenen Toten möglich ist. Darabont fragt in erster Linie, wie ein rationaler Mensch mit so einer Situation fertig werden kann. Seinen Protagonisten schickt er traumwandlerisch durch die veränderte Welt, wo der nicht in der Lage ist, die Ereignisse rational zu erfassen. Der Provinz-Deputy Rick Grimes wird ebenso traumwandlerisch hervorragend verkörpert von Andrew Lincoln. Mit ihm wird der blutige Horror auf eine schmerzliche Tragödie heruntergebrochen. Erklärungen werden kommen, kein Zweifel, aber Deputy Sheriff Rick Grimes muss erst einmal zu überleben verstehen. Ähnlich wie der Zuschauer die Situation zu begreifen lernen muss. Und man begreift diese absurde Welt als ebenso absurden Fakt, weil sich die Geschichte trotz aller Brutalität auf die Menschen fixiert. Die Pilotfolge beginnt mit drei verschiedenen Einstiegen. Der Erste bereits in der Zeit nach der Apokalypse und mit einem kurzen Ausblick auf die unschönen Seiten des Lebens. Der Zweite skizziert kurz das Leben von Deputy Grimes und seinem Freund und Partner Shane vor dem Ausbruch in ihrer Kleinstadt, in einem nur scheinbar willkürlichen Dialog. Schließlich beginnt die Folge, als Grimes nach einem Unfall aus dem Koma erwacht. Das Krankenhaus wirkt verlassen. Dem nach Erklärungen suchenden Rick Grimes strecken sich durch eine mit Ketten gesicherte Tür nur unnatürlich bleiche und knochige Finger entgegen.
Der Schlaumeier unter den Lesern schreit natürlich sofort nach Plagiat. Allerdings ist das völlig unangebracht. Den aus dem Koma in eine für ihn katastrophal veränderte Welt erwachende Helden gab es auch schon vor 28 DAYS LATER. Also, Ruhe bewahren. Es ist ein hervorragendes Stilmittel, den richtigen Ton der Serie zu gestalten, ohne sich mit der lauten und chaotischen Szenerie der vorausgegangenen Veränderung auseinandersetzen zu müssen. Der Zuschauer muss die Umstände nicht zwingend erfahren, nicht sofort. Warum auch, der vom Zuschauer begleitete Protagonist findet seine Erklärungen auch erst später. Es wird eine Folge geben, oder zumindest Szenen in einer Folge, wo Erklärungsversuche für die Apokalypse unternommen werden. Davon muss man einfach ausgehen, und sicherlich wird das auch sehr spannend umgesetzt. Doch für den zuschauerbindenden Einstieg bleibt es noch irrelevant.
Als guter Ermittler vermutet Rick Grimes nach wenigen Hinweisen, dass seine Frau und der gemeinsame Sohn in Atlanta Schutz gesucht haben müssen. Weil Sprit Mangelware geworden ist, steigt Grimes vom Polizeiwagen aufs Pferd um und macht sich auf den Weg in die Großstadt. Sein vorher abgesetzter Hilferuf über CB-Funk wird in einem Zeltlager außerhalb Atlantas gehört, die Rückrufe kann Grimes allerdings nicht empfangen. An diesem späten Punkt der Episode schlägt die Handlung einen (ersten) Bogen für den weiteren Verlauf, als man Grimes Frau das erste Mal auf einem Foto zu Gesicht bekommt. Grimes Foto seiner Frau, in Bezug auf die Ereignisse im Zeltlager außerhalb Atlantas, werden einige Zuschauer sehr leicht missverstehen. Es kann durchaus passieren, dass man diesem Wendepunkt eine ganz billige Dramaturgie unterstellen wird. Doch Darabonts Drehbuch offenbart dabei seine eigentliche Genialität. Der Anfangs bereits erwähnte, scheinbar willkürliche Dialog, entpuppt sich als sehr wichtige Klammer für die sich später offenbarende Situation.
Währenddessen reitet Grimes in das sprichwörtlich ausgestorbene Atlanta. Und da muss er umgehend feststellen, dass das Stadtleben eben doch nicht so beschaulich ist, wie auf dem Land. Ausgestorben heißt eben in dieser neuen Welt, Unmengen von wandelnden Toten. Mit einem erdrückenden Cliffhanger endet dieser in allem überzeugende Pilotfilm. Und umgehend schreit der Zuschauer nach mehr.
Spärliche Musikuntermalung, elegische Kamerafahrten und exzellente Darsteller. Dass es schwer sein muss, dieses Niveau zu halten, steht außer Frage. Aber es sind Zombies, da ist alles drin. Das Genre ist alles andere als neu, also gibt es Szenen, die man schon einmal gesehen hat, und es wird im Verlauf der Serie noch einige Szenen geben, die man andernorts schon besser inszeniert gesehen hat. Möglich. Aber gerade mit diesem Pilotfilm ist es durchaus möglich, dass diese Toten auf vollkommen neuen Wegen wandeln werden. Es wird sich zeigen.
Schon jetzt kann man sagen, dass AMC mit diesem Programm eine Vorreiterrolle übernommen hat, wo Nacheiferer nicht sehr lange auf sich warten lassen dürften. Die Freizügigkeit, mit der Gewalt mittlerweile im Fernsehen vermittelt wird, hat für das Horror-Genre ein sehr weites Feld geöffnet. Und gerade für den gemeinen Zombie ist das Fallen der restriktiven Grenzen von graphischer Gewalt von größter Wichtigkeit. Denn was hat der Zombie schon zu bieten? Ihm fehlt ja die Magie eines Vampirs, oder die Faszination über die derbe Männlichkeit von Werwölfen. Der Zombie fault, stinkt und beißt sich so durchs Leben. Gregory Nicotero hat sich als neuer Hohepriester für Special-Makeup einiges für WALKING DEAD einfallen lassen.
Selbstverständlich explodieren da die einen oder anderen Köpfe, die Sache will es. Aber Nicoteros Konzept des wandelnden Toten sieht gleichzeitig eine Annäherung der eigentlichen Fressmaschinen an einen eigenständigen Charakter vor. In den Massenszenen mit hunderten und mehr Zombies werden die Statisten in drei Kategorien von unterschiedlich ausführlichem Make-up und Kostüm eingeteilt, um den Aufwand im finanziell vertretbaren Rahmen zu halten. Im Bildhintergrund die kaum erkennbaren Figuren, ohne prothetische Veränderungen. Im Mittelbereich des Kamerabildes tummeln sich die schon etwas differenzierteren Kollegen mit größeren, aber noch nicht aufwändig geschminkten Verwundungen und Abnutzungserscheinungen. Der gruselige Clou liegt in den gut ins Bild gesetzten Zombies, wo jede Figur als Überrest eines tatsächlich menschlichen Individuums erkennbar sein muss. Dieses verwesende Bündel des erhobenen Zeigefingers der Sterblichkeit als eigenständiger Charakter. Das verfehlt nicht seine Wirkung.
Der Einstieg der sechsteiligen Staffel ist jedenfalls gelungen. Die ungewöhnliche Laufzeit von 65 Minuten verdeutlicht, wie viel Rücksicht auf die Atmosphäre und das richtige Tempo genommen wurde. Weder wollte man diesen Appetithappen in die 45-Minuten-Schablone pressen, noch mit Unsinnigkeiten auf 90 Minuten aufblasen. Auf vielen Seiten kann man eine Laufzeit von 90 Minuten nachlesen. Das ist aber dem eigenartigen Umstand zu verdanken, dass in Amerika stets die Programmlänge angegeben wird, die Werbung also mit eingerechnet wird. Die restlichen Folgen werden mit einer regulären Laufzeit von zirka 45 Minuten angekündigt. Aber man kann es wirklich verkraften, sollte sich die Macher für eine längere Laufzeit entscheiden. Wenn sie qualitativ halten können, was sie mit dem Pilotfilm versprochen haben, kann es nicht lange genug gehen.
Man denke nur an diese eine Szene: Deputy-Sheriff Rick Grimes mit einem Zombie im Park. Ein wahrliches Gänsehaut-Erlebnis, wie es Fernsehen nur ganz selten gelingt. Da hat sich wirklich etwas eingebrannt.
THE WALKING DEAD: 01×01 – Days Gone Bye
Darsteller: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies, Jeffrey DeMunn, Steven Yeun, Chandler Riggs u.a.
Regie und Teleplay: Frank Darabont nach den Comics von Robert Kirkman (auch Produzent) – Kamera: David Tattersall – Originalmusik: Bear McCreary – Bildschnitt: Hunter M. Via – Produktionsdesign: Gregory Melton – Special-Makeup-Effects: Greg Nicotero
USA / 2010 – zirka 65 Minuten
The Walking Dead – Guts
ausgeweitet und gespoilert
Der Deutschlandstart zu dieser Serie verlief enttäuschend. Der über das Paket von Sky empfangbare FOX-Channel strahlte die Pilotfolge im falschen Bildformat aus, was nur durch experimentelle Einstellungsversuche an Decoder und Bildschirm in den Griff zu bekommen war. Zudem fehlte die angekündigte englische Tonspur. Doch bleibt die Hoffnung, dass die Fehler im Format und Ton vielleicht nur regional bedingt waren.
Wesentlich schlimmer: Die erste Folge war um 20 Minuten kürzer als in der amerikanischen Erstaustrahlung. Nicht etwa, dass man dem Zuschauer die Grausamkeiten ersparen wollte, ganz im Gegenteil, man kürzte an Dialogen und innerhalb der Szenenabläufe. Allein die viereinhalbminütige Einstiegssequenz war um zwei Minuten gestrafft. Erklärungen findet man weder bei Fox noch in irgendwelchen Foren. Kein guter Start, wenn man sich ein Publikum schaffen will. Noch dazu ein sehr begieriges Publikum, das in den letzten sechs Monaten richtig heiß gemacht wurde. Sehr, sehr ärgerlich. Ein Mensch wie Frank Darabont hat seinen guten Ruf nicht von ungefähr, deswegen sollte man annehmen, dass er sich vielleicht etwas dabei denkt, Szenen auf gewisse Längen hin zu konzipieren.
Im herkömmlichen Serienformat von 45 Minuten geht es bei WALKING DEAD in die zweite von sechs Runden, allerdings in diesem Sinne auch so angedacht. War Episode eins eine episch ruhige Erfassung von Exposition und Status quo, fließt die zweite Episode in gewöhnlicheren Serienwassern. Wobei die Wortwahl „gewöhnlich“ mit äußerster Vorsicht zu genießen ist. Was man bei GUTS sieht, hat man so noch nicht in einer Fernsehserie gesehen. Das englische Guts im Titel steht dabei für alle seine verschiedenen Bedeutungen im Deutschen, aber am auffälligsten für das Gedärm.
In einer Art sanften Übergangs hat Frank Darabont auch für diese Episode das Drehbuch verfasst, den Regiestuhl aber Michelle MacLaren überlassen. MacLaren hat schon in verschiedenen Spannungsserien Regie geführt, ist aber eher als Produzentin für HARSH REALM, den X-AKTEN, etlichen Fernsehfilmen und der ebenfalls von AMC gemachten Serie BREAKING BAD aufgefallen. Ihre bisherige Arbeit mit Thriller- und Horrorelementen ist ganz offensichtlich und hörbar für WALKING DEAD von unschätzbarem Wert.
Aber welch trauriger Schnitzer schleicht sich da gleich zu Beginn ein? Mit einer vom Handlungsverlauf losgelösten Sequenz beginnt auch diese Episode. Aber muss es denn unbedingt eine Frau sein, die alleine zum Pilzesuchen in den Wald geht? Noch dazu handelt es sich um die Angetraute unseres Helden Rick Grimes. Welcher Drehbuchschreiber schickt nach einem Zombie-Ausbruch eine Frau alleine in den Wald und erschreckt sie dann auch noch mit knackenden Zweigen? Und wer glaubt, dass Lori Grimes wirklich in Gefahr ist, wenn sie ihrem Mann noch nicht begegnet ist? Beide haben da ja noch einiges zu klären. Es ist ein lausiger Spannungsmoment, der ziemlich billig wirkt und deshalb mehr verärgert, als dass er unterhält.
Um ein Vielfaches spannender ist Deputy Grimes‘ Flucht aus dem Panzer, in den er sich vor den Menschenfleisch fressenden Horden retten musste. Er trifft auf eine Gruppe, die zu dem Lager außerhalb der Stadt gehört, in dem sich Lori und Ricks Kumpel und Kollege Shane befinden. Ach nein, Lori und Shane befinden sich ja nicht im Lager, sondern in verfänglichen Positionen auf dem Waldboden. Durch Grimes unvorsichtiges Verhalten am Panzer werden die wandelnden Toten auch auf die Gruppe aufmerksam, die sich bisher unauffällig in der Stadt aufhielt, um sich mit Proviant zu versorgen.
Oberflächlich betrachtet ist Folge zwei eine einfache Cut-and-run-Episode, wobei auch hier das Cut in seiner eigentlichen Bedeutung zu verstehen ist. Doch die Folge zeigt auch behutsam Rick Grimes‘ Entwicklung in dieser für ihn neuen Welt. Aus dem lethargisch seinem Ziel folgenden Familienvater bricht langsam die Führungspersönlichkeit heraus, die er als Deputy-Sheriff auch haben sollte. Doch in einer aus den Fugen geratenen Welt die Oberhand zu behalten ist sehr schwer. Es gibt eben nicht mehr viele Menschen, die sich Typen wie Merle Dixon entgegenstellen, einem rassistischen und rücksichtslosen Proleten direkt aus dem Redneck-Handbuch. Michael Rooker verkörpert diesen fiesen Sack mit fieser Finesse. Noch bevor er seine Tiraden beendet hat, möchte man ihn schnellstens vom Dach schubsen. Grimes hingegen fesselt ihn mit Handschellen an ein Stahlgestell. Unglückliche Umstände führen dazu, dass er dort auch noch eine ganze Weile gefesselt bleiben wird.
Der Zombie der Woche ist William Dunlap. Dunlap nimmt hier die Stellung des sogenannten Bike-Girls aus dem Pilotfilm ein. Es ist dieser emotionale Faustschlag, den man in einer absolut ekelerregenden Sequenz einfach nicht erwartet. Um an einen entfernt stehenden LKW zu kommen, möchte sich Grimes mit Blut und Innereien eines Zombies eindecken, um von den Wandlern auf der Straße nicht als lebende Beute gerochen zu werden. Sein neuer Kumpel Glenn muss ihn dabei unterstützen, damit die sechsköpfige Gruppe endlich aus der Stadt verschwinden kann. Um sich notwendiges Verschleierungsmaterial zu besorgen, muss man natürlich einen Zombie erst mal zerlegen, und das geschieht hier nicht fachgerecht. Aber bevor der erste Axthieb niedergeht, beugt sich Grimes unvermittelt nach unten, greift nach der Geldbörse des vermeintlichen Lieferanten von Todfleisch und liest der Gruppe den Namen auf dem Führerschein vor. Rick Grimes gibt den vormals wandelnden Toten seine Würde zurück, er verdeutlicht ihn selbst als Opfer dieser unglaublichen Ereignisse. William Dunlap wird wieder zu einem Menschen, auch wenn er anschließend weniger schönen Dingen zum Opfer fallen wird.
Der Blutgehalt in dieser Folge ist enorm und kein Vergleich zu der nun als milde anzusehenden Pilotfolge. Dabei arbeiten die Effekte-Leute nicht einfach nur mit extrem grafischen Darstellungen, sondern leisten auch auf der Ton-Ebene einen extrem schaurigen Beitrag. Wenngleich Musik sehr selten und nur unterschwellig eingesetzt wird, sind Baseballschläger auf Schädeldecken und Äxte in Kinnladen wunderbar zu hören. Da wird an Volumen nicht gespart. Auf diese Art verdoppelt man leicht die Zahl der Grausamkeiten, ohne diese wirklich alle zeigen zu müssen. Wobei man eigentlich auch nicht an dem gespart hat, was der Zuschauer zu sehen bekommt.
Oberflächlich betrachtet, ist Folge zwei also tatsächlich nur eine einfache Cut-and-run-Episode. Aber was die Macher alles mit hineingepackt haben, ist erstaunlich. Da bedarf es keiner philosophischen Ausschmückungen oder des moralischen Zeigefingers. Bis auf den leidlichen Anfang werden auch weitgehend Serien-Standards und Inszenierungsklischees umgangen. Trotzdem oder vielleicht auch deswegen, transportiert auch diese zweite Folge sehr viel an emotionalem Gehalt. Und der ergibt sich aus den kleinen Gesten und unaufdringlichen Dialogen, die sich dieser grausam kalten Welt entgegenstellen.
Ganz großes Kino für den kleinen Bildschirm.
THE WALKING DEAD: 01×02 – Guts
Darsteller: Andrew Lincoln, Laurie Holden, Michael Rooker, IroniE Singleton, Steven Yeun, Jeryl Prescott, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies, Emma Bell, Jeffrey DeMunn, Chandler Riggs u.a.
Regie: Michelle Maxwell MacLaren – Teleplay: Frank Darabont nach den Comics von Robert Kirkman (auch Produzent) – Kamera: David Boyd – Originalmusik: Bear McCreary – Bildschnitt: Julius Ramsay – Produktionsdesign: Gregory Melton – Special-Makeup-Effects: Greg Nicotero
USA / 2010 – zirka 45 Minuten
The Walking Dead – Tell It To The Frogs
zerfleddert und gespoilert
Episode drei, Tell It To The Frogs, läuft seit dem 19.11. im Fox-Channel Deutschland. Erneut wird im Sky-Paket keine englische Tonspur angeboten. So macht das wirklich keinen Spaß. Aber wenigstens hat Fox endlich mitgeteilt, dass der Pilotfilm für den gesamten Markt außerhalb Amerikas um 20 Minuten gekürzt wurde, um überall besser ins Programmschema zu passen. Kein Land hat aber stringentere Schemen als das amerikanische Fernsehen. Seltsame Argumentation. Da gehen Programmstrukturen eben über Kunst. Eine Serie über Zombies? Kunst?
Familienzusammenführung im Camp der Überlebenden außerhalb Atlantas. Deputy-Sheriff Rick Grimes trifft endlich auf seine Frau und den gemeinsamen Sohn. Rick ist gerührt, Lori schockiert. Sein Kollege und Kumpel Shane, der sich körperlich bisher sehr gut um Lori kümmerte, ist ratlos. So ist es zum Happy-End noch eine Weile hin, denn so viele Dinge sind liegengeblieben und müssen erst ins Reine gebracht werden.
Wirklich überraschend war es nicht, dass man Michael Rooker als rassistisches Großmaul Merle Dixon noch einmal sehen würde, zu prägnant und einnehmend war seine Figur im Vorgänger. Wäre sein Ende mit dem Ende der zweiten Episode besiegelt gewesen, hätte das einen zusätzlichen, schockierenden Aspekt auf diese neue Welt der wandelnden Toten geworfen. So verpufft der Effekt ein wenig. Dafür darf man im Teaser eine grandiose Darbietung aller Facetten menschlicher Verzweiflung erleben, die der mit Handschellen ans Hochhausdach gefesselte Dixon durchleben muss. Zudem klopfen schon die hungrigen Mäuler begierig an die Tür, um auf das Dach zu gelangen.
Tell It To The Frogs ist keine wirklich gute Folge. Ist inhaltlich Folge zwei schon im Vergleich zum Pilotfilm abgefallen, dominieren in Nummer drei ganz eindeutig starke Schwächen die Inszenierung. Charakterzeichnungen und Dialoge bewegen sich im Rahmen einer handelsüblichen, aber auch nicht sehr originellen Serie. Sarah Wayne Callies hat als Lori ihren – wenngleich tot geglaubten – Mann betrogen. Ihre Reaktion auf ihn und seine Präsenz ist alles andere als herzlich. Grimes müsste eigentlich sofort auffallen, dass dies nichts damit zu tun hat, dass er doch noch am Leben ist, sondern dass irgendetwas zwischen ihnen steht. Und dass etwas zwischen ihnen steht, versucht Wayne Callies in jeder Szene leider allzu offensichtlich zum Ausdruck zu bringen. Die Regie hat sie nicht daran gehindert.
Nach drei Folgen ist noch immer nicht ersichtlich, wie groß die Zeltstadt eigentlich wirklich ist, wie viele Überlebende sich da versammelt haben und warum man sich ausgerechnet in einem unübersichtlichen Waldstück sicher fühlen sollte. Hier hat sich das Production-Design aus unerfindlichen Gründen zu sehr zurückgehalten. Da fast die gesamte dritte Episode im Camp spielt, bleiben diese Fragen allgegenwärtig. Es macht keinen Sinn. Oder vielleicht macht es den, aber es wird in keiner Weise vermittelt. Als treuer Zuschauer bin ich schließlich an der Welt interessiert, die ich von meinem Sofa aus bewundern möchte. Doch mangelt es an Überblick und Erklärungen, wo beides eigentlich angebracht wäre.
Die Frauen machen selbstverständlich den Haushalt, waschen die Wäsche im nahen Baggersee und bügeln dank eines Stromgenerators die Blusen und Hosen. Ist das die Welt nach der Apokalypse, dass sich Frauen in Rollen wiederfinden, aus der sie hundert Jahre harten Kampfes zuvor ausgebrochen sind? Selbstredend sitzen die Männer nichtstuend bei den arbeitenden Frauen oder vertreiben sich derweil ihre Zeit im See. Beim Aufbegehren gegen diesen Missstand werden umgehend altbekannte und weit überholte Klischees freigesetzt. Maul halten und weiterarbeiten, oder die nächste schallende Ohrfeige ist sofort verteilt. Es ist ein sehr billiges Szenario, mit dem Regisseurin Horder-Payton versucht, Veränderungen in den sozialen Strukturen zu verdeutlichen. Natürlich werden solche Szenen vom Drehbuch vorgegeben, doch in der Inszenierung muss man einfach sehen, dass sie bei einer realistischen Umsetzung nicht funktionieren.
Genauso wenig funktioniert Norman Reedus‘ Figur von Daryl Dixon, der sich nicht eine Nuance von seinem auf dem Dach zurückgelassenen Bruder unterscheidet – weder in Aussehen und Sprache noch im Habitus. Mit Ausnahme von Rick und Shane brechen sich alle Charaktere auf Stereotypen herunter, die wenig überzeugen und kaum Tiefe besitzen. Spannend ist das nicht anzuschauen, weil die Personen weder interessant sind noch zu überraschen vermögen. Selbst Leinwand-Urgesteine wie Jeffrey DeMunn oder Laurie Holden halten nicht im Geringsten, was ihre Namen versprechen.
Gwyneth Horder-Payton hat durch ihre fehlenden Regieeinfälle und ein mangelndes Gespür für das Besondere in dieser Ausnahmeserie The Walking Dead noch mal eine Stufe nach unten Richtung Standard-Fernsehen gedrückt. Sollten sich Drehbuch und Inszenierung am Ende wirklich nahe an der Comic-Vorlage halten, dann ist das nur ein Zeichen, dass sich zwei verschiedene Medien eben nicht im selben Stil umsetzen lassen, weil sie jeweils anderen Gesetzen unterliegen. Sollte man hat sich aber so weit von der Vorlage entfernt haben, dass die angeführten Schwächen darauf zurückzuführen wären, dann ist grundsätzlich etwas im Argen.
In einer Szene tut sich ein Zombie in der Nähe des Camps an einem Hirsch gütlich, was die ihn entdeckenden Kinder sofort zur Hilfe schreien lässt. Abgesehen von der Bestätigung der Frage, warum man ein Camp in der unübersichtlichen Lage eines Waldstückes aufschlägt, beherbergt das Szenario einen ganz anderen Aspekt. Die gesamte herbeieilende Männerschaft schlägt mit Stangen und Knüppeln auf den ungebetenen Gast ein, bis dieser schließlich von einer Axt geköpft und der noch zuckende Kopf von einem Pfeil durchbohrt wird. Im Ansatz hat diese Szene etwas radikal Archaisches. Diese im stummen Einvernehmen auf den Eindringling einschlagende Meute ist wesentlich näher an Neandertal als an Atlanta. Im Sumpf des Serieneinerleis, in den diese Sequenz eingebettet ist, verpufft aber beinahe die Wirkung dieses Rückfalls in die Zeit von Sammler und Jäger. Das Geschehen hätte zu einem emotionalen Höhepunkt gereicht, wenn es wesentlich bewusster inszeniert worden wäre.
Dafür gibt es einen stimmungsvollen und Mut machenden Cliffhanger. Denn unser Held Rick Grimes muss natürlich noch einmal zurück in die von wandelnden Toten überfüllte Stadt, um unerledigte Geschäfte zu Ende zu bringen. Doch zu seinem und dem Entsetzen der ihn begleitenden Gefährten muss er feststellen, dass die Zombies nicht zwangsläufig das größte Problem in dieser vollkommen auf den Kopf gestellten Zivilisation sein müssen. Denn der gemeine Zombie will ja nur was zum Knabbern. Genauer betrachtet stellt der gewöhnliche Tote keine großen Ansprüche und bleibt dabei berechenbar. Und dieser Cliffhanger hat das Potenzial, das Pferd wieder am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Möge dieser Akt gelingen, denn Folge drei bringt erworbene Reputationen erheblich ins Wanken.
THE WALKING DEAD: 01×03 – Tell It To The Frogs
Darsteller: Andrew Lincoln, Laurie Holden, Jon Bernthal, Andrew Rothenberg, Michael Rooker, Norman Reedus, Juan Pareja, IroniE Singleton, Steven Yeun, Jeryl Prescott, Sarah Wayne Callies, Emma Bell, Jeffrey DeMunn, Melissa McBride, Adam Minarovich, Madison Lintz, Maddie Lomax u.a.
Regie: Gwyneth Horder-Payton – Teleplay: Charles H. Eglee, Jack LoGiudice, Frank Darabont – nach den Comics von Robert Kirkman (auch Produzent) – Kamera: David Boyd – Originalmusik: Bear McCreary – Bildschnitt: Hunter M. Via – Produktionsdesign: Gregory Melton – Special-Makeup-Effects: Greg Nicotero
USA / 2010 – zirka 45 Minuten
The Walking Dead – Vatos
durchgekaut und gespoilert
Eine wahrlich offenbarende Folge. Sie bestätigt endlich einmal den Verdacht, dass es eine sehr blöde Idee sein kann, in einer Welt voller Zombies mitten im Wald ein Camp von Überlebenden einzurichten. Wie übersichtlich soll das denn sein? Wie sicher kann das werden? Sicher ist da was anderes, aber da würde man dem Ende vorgreifen. Zuerst gibt es lange Gespräche zwischen Andrea und ihrer um zwölf Jahre jüngeren Schwester Amy, philosophische Abhandlungen am Lagerfeuer und einige Überraschungen mit einer Bande Chicanos. Mit einigen sehr gelungenen Kniffen wird verdeutlicht, wie verwirrend das Leben zwischen den Lebenden geworden ist. Meister Kirkman selbst hat sich um das Schreiben des Drehbuchs bemüht. Robert Kirkman kennt seine Welt ja wohl am besten, und das merkt man auch an den verschiedenen Ebenen der Erzählung.
Dies ist keine Welt mehr, in der es um den Konflikt Mensch gegen wandelnde Tote geht. Vielmehr sind die sozialen Strukturen so weit aufgebrochen, dass es immerfort zu Auseinandersetzungen unter den Überlebenden kommen kann und meist auch kommt. Andrea und Amy stellen zum Beispiel fest, dass sie gar nicht so gut miteinander harmonieren, wie man eigentlich von Geschwistern in einer solchen Situation erwarten würde. Und das Team um Deputy-Sheriff Rick Grimes muss einen überlebenden Mexikaner als Geisel nehmen, dessen Gang im Gegenzug Kumpel Glenn entführt. Die Lage zwischen den beiden Gruppen eskaliert, weil die Mexikaner auf Grimes Waffentasche beharren, welche dieser natürlich nicht hergeben kann. Ein Gefangenenaustausch wird dabei unwahrscheinlich.
Wie verdreht und aus den Fugen geraten diese Welt ist zeigt sich, als dann die wahren Absichten der Gruppe Mexikaner aufgedeckt werden. Es ist absurd, aber es ist auch sehr real und nachvollziehbar. Autor Kirkman gelingt es mit diesem Handlungsstrang sehr gut, sein Publikum zu überraschen. Zumindest die, die seine Vorlage nicht gelesen haben. Er zeigt auf, wie selbstverständlich sich Zivilisation selbstregulierend ihren Gegebenheiten anzupassen versteht und dabei ihre ursprüngliche Bedeutung verliert. Auf der einen Seite geben sich die Chicos als knallharte Gangster, auf der anderen entpuppen sie sich dann doch als gebrochene Samariter. Diese Sequenz steht als letzte aber doch in einer Reihe mit dem „Bike-Girl“ aus dem Pilotfilm und dem Geschehen um William Dunlap in der zweiten Folge.
Nichts ist mehr so, wie es scheint. Und nichts ist so, wie es sein könnte. Zu allem Überfluss ist auch noch Merle Dixon irgendwo in Atlanta unterwegs, der sich anscheinend selbst aus seiner misslichen Lage auf dem Dach befreien konnte. Und Merle allein unterwegs kann nur bedeuten, dass er sehr viel gegen das Camp gerichteten Zorn mit sich herumschleppt. Jim, ein Überlebender im Camp, dreht durch und muss von Shane gefesselt werden, um ihn vor einem Hitzschlag zu schützen. Und der von Shane in der letzten Episode ebenfalls gemaßregelte Ed schmollt seine herausgeprügelte Ehre im Zelt aus und verweigert den Kontakt zu den anderen. Der Mensch ist als Überlebender sich selbst sein ärgster Feind geworden. Das Ende des Zusammenhalts scheint nahe zu sein. Aber so ist das in Zeiten der Anarchie.
Als Stimme der Vernunft darf Jeffrey DeMunn als Dale am Lagerfeuer altbekannte, aber dennoch stimmungs- und wirkungsvolle Weisheiten vom Stapel lassen. Jeden Tag, exakt um dieselbe Zeit, zieht er seine Uhr auf. Ein Ritual, das für ihn sehr wichtig ist, denn die Uhr dient ihm nicht dazu, sich an die Zeit zu erinnern. Vielmehr ermöglicht ihm die Uhr, die Zeit auch einmal vergessen zu können. Das ist sehr schön ausgespielt, und dieses Ritual wirkt wie ein letzter Funke in einem erlöschenden Feuer. Und während Dale die Geschichte zu seiner Uhr erzählt, können auch seine Zuhörer die Zeit für einen Augenblick vergessen. Diese Sequenz wirkt zuerst wie ein tröstlicher Appell an die Vernunft und vermittelt Zuversicht für die Menschlichkeit.
Doch dies ist eine Welt, in der sich die Toten erheben und auf Erden wandeln. Schmutzige, verwesende Wesen, die schlecht riechen und denen jede Aura des Mysteriösen abgeht. Man wird ihrer nicht Herr, sie sind nur hässliches Sinnbild für die Verrohung eines ohnehin instabilen Systems, in dem sich eine vernunftorientierte Welt bewegt. Der nach frischem Menschenfleisch gierende Tote ist die Verkörperung von Instinkt in reinster Form. Hier wird Dales romantisierende Lagerfeuerweisheit von einer erwünschten Zustandsbeschreibung in eine Grabrede verkehrt. Was bleibt, ist lediglich die Vorstellung einer Welt, die man vermisst, die aber aufgehört hat zu existieren. Mit einer überraschenden und sehr blutigen Attacke endet die vierte Episode. Ein grausames Folgenfinale, das Dales Worte als fiktiv gewordenes Ideal entlarven wird.
Robert Kirkmans Drehbuch kann noch nicht ganz wettmachen, was die dritte Folge dem Zuschauer an Enttäuschungen gebracht hat. Aber „Vatos“ zeigt wieder eindeutig das Potenzial, das diese morbide Welt so faszinierend macht. Unheimlich, düster und unvorhersehbar. Kleine Logiklöcher haben sich eingeschlichen, aber die sind zu verschmerzen, denn wenn erst einmal die Zombies Rambazamba machen, bleibt kein Knochen auf dem anderen. Wenn die Protagonisten dann am Ende im Blut stehen, war der wandelnde Tote vielleicht die Form der Exekutive. Doch man weiß selbst im Chaos des Entsetzens, dass die Recht sprechende Gewalt woanders lag.
Ist das Gemetzel noch so groß, bleibt kein Zweifel, dass die größte Gefahr für den überlebenden Menschen immer noch von den anderen überlebenden Menschen ausgeht.
THE WALKING DEAD: 01×04 – Vatos
Darsteller: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Sarah Wayne Callies, Laurie Holden, Jeffrey DeMunn, Steven Yeun, Emma Bell, Chandler Riggs, IroniE Singleton, Andrew Rothenberg, Norman Reedus, Neil Brown Jr., Nopel Gugliemi, Anthony Guajardo u.a.
Regie: Johan Renck – Teleplay: Robert Kirkman – nach seiner Comic-Serie (auch Produzent) – Kamera: David Boyd – Originalmusik: Bear McCreary –
Bildschnitt: Sidney Wolinsky – Produktionsdesign: Alex Hajdu – Special-Makeup-Effects /Consulting Producer: Greg Nicotero USA / 2010 – zirka 45 Minuten
THE WALKING DEAD – WILDFIRE
ausgeschlachtet und gespoilert
Deputy-Sheriff Rick Grimes ist verzweifelt. Als einzig vernünftige Instanz im Land von Blut und Tod konnte er ein Massaker im Camp nicht verhindern. Ein Verbiss, der am Ende mehr Opfer fordern wird, als es anfangs den Anschein hat. Zu allem Überfluss kann er auch Morgan und seinen Sohn nicht erreichen, jene Menschen, die ihm im Pilotfilm das Leben gerettet haben. Ausgemacht war ein steter Kontakt über Funkgerät, aber Morgan antwortet nicht. Rick befürchtet, dass die von ihm angefunkten Vater und Sohn bereits auf den Weg nach Atlanta sind. Nicht nur als Polizist, sondern auch als Freund muss er Morgan davor warnen, dass die Stadt überrannt wurde und nicht sicher ist. Die Verzweiflung misst sich nicht allein darin, nicht helfen zu können, sondern vor allem darin, in absoluter Unsicherheit zu bleiben. Es ist eben keine Welt mehr, die mit Text-Nachrichten oder einem Anruf beim freundlichen Nachbarn geregelt werden kann. Allein mit einem Funkgerät in der Hand spielt Andrew Lincoln die Szene perfekt aus. Er definiert sich damit nicht nur als Herzstück der Serie, sondern beweist erneut, dass er sie auch zu tragen versteht.
Der diesmal zweigeteilte Teaser ist ein raffiniertes Exposé über den Verlust von Zwischenmenschlichkeit. Während Rick den Kontakt zu den Lebenden sucht, die bereits schon tot sein könnten, kniet Andrea über ihrer toten Schwester Amy, in der absurden Hoffnung, der Zustand könne sich umkehren. Ein ansprechender Einstieg, der regelrecht in diese Folge hineinzieht. >Wildfire< ist eine Episode, die nach der gelungenen Abhandlung von sozialer Struktur und Verantwortung in >Vatos< in einen absoluten Charakter-Modus hochschaltet. Hatte >Tell It To The Frogs< noch mit Schwächen im fehlenden Zusammenspiel von Dialog und Charakter, Regie und Zuschauererwartung zu kämpfen, überträgt Glen Mazzaras Buch in >Wildfire< die emotionale Betroffenheit der einzelnen Figuren wesentlich gefasster auf die vom Chaos beherrschte Gesamtsituation.
Während Rick und Andrea weder von ihrer Hoffnung ablassen können noch ihrer Verzweiflung wirklich Herr werden, schließt Carol sehr präzise mit der Ursache ihres bisher widrigen Lebens ab. Auch ihr prügelnder Gatte Ed fiel der vorangegangenen Attacke zum Opfer. Doch während andere im Lager mit einer Spitzhacke dafür sorgen, dass die Toten sich auch wirklich nicht mehr erheben, besteht Carol darauf, ihrem verblichenen Mann diesen Dienst persönlich schuldig zu sein. Aber mit nur drei Schlägen wird sehr deutlich, dass Carol hier keine erlösende Handlung vornimmt, sondern einen für sich befreienden Akt vollzieht. Diese kurze Sequenz hätte sehr plakativ geraten können, wären da nicht Melissa Suzanne McBrides zurückhaltendes Spiel und das ideale Timing im Schnitt. Anstatt, wie für das Fernsehen üblich, Emotionen überproportional zu inszenieren, setzt man auf die Wirkung subtiler Zwischentöne. Hier findet selbst das verwöhnteste Publikum seinen gelungenen Schauer. Zudem ist genau das die kleine Würzmischung, die >Walking Dead< so schmackhaft macht.
Der Zusammenhalt der Gruppe bricht auseinander. Während die einen das Zeltlager nicht mehr für sicher halten, glauben die anderen nur an einen einmaligen Zwischenfall. Die Gemeinschaft bewährt sich nicht mehr. Rick Grimes entgeht dabei allerdings, dass sein ärgster Feind ihm ständig gegenübersteht. Glaubt Rick in seinem Kumpel Shane ein ihn ergänzendes Element zu haben, weil dieser ständig Entscheidungen oder Meinungen in Frage oder zur Diskussion stellt, hat Shane längst seine Fronten für sich geklärt. Er möchte in dieser ohnehin traurigen Welt nicht auf Lori verzichten, die selbstredend in die Arme ihres zurückgekehrten Rick gefallen ist. Um dieses Umstand zu ändern, spielt Shane sogar mit dem Gedanken der wirklich letzten Konsequenz. Dass ihm dabei ausgerechnet der altersweise Dale auf die Schliche kommen muss, erhöht noch das Konfliktpotenzial. Und es erhöht ungemein die Spannung für den Zuschauer. Denn was hier im Argen ist, muss aufgelöst werden, das muss heraus. Und es wird auf kurz oder lang zur Konfrontation kommen.
Da ein Mitglied der Gruppe während des vorangegangenen Angriffes gebissen wurde, besteht Rick darauf, endlich das Zentrum für Seuchenkontrolle CDC aufzusuchen. Die Gruppe spaltet sich, das Camp wird aufgelöst. Der gebissene Jim allerdings schafft die Reise nicht mehr. Zu groß ist die Gefahr, er könnte jemanden verletzen. Anstatt ihn gezielt zu töten, lässt er sich an einer schönen Stelle am Waldweg aussetzen. Eine schöne Stelle, von der er bald nichts mehr haben wird, wenn seine Augen trübe werden und das Fieber nachlässt. Wenn er schlurfend durch den Wald wandelt, nur von der Lust getrieben, etwas Warmes zwischen die Zähne zu bekommen. Anders als bei Amy, bei der man die Verwandlung erlebt und ihren Kopfschuss gesehen hat, wird Jim am Ende eine jener anonymen Kreaturen sein, die niemand aus ihrer Misere befreien wird. Seine Angst, vorzeitig aus dem Leben zu scheiden, solange dies noch in seinem menschlichen Bewusstsein geschieht, birgt ein grausames, für den Zuschauer nachvollziehbares Dilemma.
In den letzten zehn Minuten erfährt die Serie einen radikalen Schnitt. Einen sehr positiven Schnitt, der die gesamte Handlung in eine ganz neue Richtung bringen wird. Die Geschichte wird unvermittelt im CDC fortgesetzt. Ein armer, verzweifelter Wissenschaftler, der bislang unermüdlich am Projekt Wildfire arbeitete, beschließt, seine Arbeit zu beenden und sein Leben mit einem sauberen Selbstmord. Offensichtlich ist >Wildfire< der Codename für die Seuche, welche sinnbildlich die Gräber geöffnet hat. Dass Noah Emmerich als Wissenschaftler allein im CDC ist und sich entschlossen hat, das Zeitliche zu segnen, lässt den leisen Verdacht aufkommen, dass gegen Wildfire kein Serum gewachsen ist. Dann klingelt es auch noch an den hermetisch abgeriegelten Toren, und es sind nicht die Zeugen Jehovas.
Mit relativ wenigen Haarspaltereien ist diese Episode der bisher unblutigste Ausflug in die Zombiewelt. Und dennoch ist auch hier >Walking Dead< am stärksten, wenn der Zombie nicht bloß zur plumpen Gefahr wird, sondern als abstrakt zu begreifender Hintergrund fungiert. In der nur sechs Episoden umfassenden Staffel werden mit >Wildfire< die überlebenden Charaktere endgültig definiert. Rick Grimes hat sogar seinen Sheriff-Hut gefunden, den er in der ersten Folge zurücklassen musste. Das hat keineswegs etwas von Indiana Jones, sondern zeigt und bestätigt den Charakter als Gesetzeshüter, ohne sein Wesen totquatschen zu müssen. Regisseur Dickerson versteht es sehr gut, die Figuren in Szenen zu setzen und ihnen über ihre Dialoge hinaus mehr Tiefe zu verleihen. Es wirkt, als würden die Macher groß ausholen für den emotionalen Paukenschlag, der die erste Staffel nicht einfach nur zum Abschluss bringen soll, sondern die menschliche Ebene für die Zukunft festigen wird. Das apokalyptische Szenario von Tod und Verderben wird nicht etwa in den Hintergrund gedrängt, sondern gewinnt an Intensität. Denn im allgegenwärtigen Alptraum von Ungewissheit, Misstrauen und dem Ende der Zivilisation wird Menschlichkeit zu einem ganz besonderen Faktor des Horrors.
Der erste Eindruck bei der Ankunft in Atlanta ist düster und unheilvoll. Tote überall, die die Straßen und Wege bedecken. Allesamt Opfer und Täter zugleich. Das CDC scheint keine Rettung. Die Hoffnung verschwindet mit den Unmengen an vermoderndem Fleisch, das die kleine Gruppe Überlebender umgibt. Und doch endet die Episode mit einer strahlenden Lichtflut, in die Rick und seine Mitstreiter getaucht werden. Das könnte Hoffnung signalisieren, die mit diesem einen Bild plötzlich übermächtig präsent wird. Das macht das Warten auf die nächste Folge zu einer Tortur. Allerdings ist danach aber auch die Staffel beendet, und das machte es nur noch schlimmer.
Darsteller: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Laurie Holden, Sarah Wayne Callies, Jeffrey DeMunn, Steven Yeun, Melissa Suzanne McBride, Chandler Riggs, IroniE Singleton, Andrew Rothenberg u.a.
Regie: Ernest R. Dickerson
Teleplay: Glen Mazzara – nach den Comics von Robert Kirkman
Kamera: David Boyd
Originalmusik: Bear McCreary
Bildschnitt: Julius Ramsay
Produktionsdesign: Alex Hajdu
Special-Makeup-Effects & Consulting Producer: Grec Nicotero
USA 2010 – zirka 45 Minuten
THE WALKING DEAD – TS-19
obduziert und gespoilert
Als sich in der vorangegangenen Episode die Tore des Center for Disease Control öffneten, hüllten sie unsere Helden in das gleißende Licht der Hoffnung. Wenn die sozialen Strukturen auseinanderbrechen, dann bleibt als letzte Bastion der Normalität eine staatliche Einrichtung. Doktor Jenner als engelsgleiche Figur, der weiß gewandet den Bedürftigen Einlass gewährt. Natürlich stirbt die Hoffnung zuletzt, und sie erhebt sich immer und immer wieder, wenn man ihr nicht das Hirn rausbläst.
Und die Tücken des Fortschritts setzen der Hoffnung immer und immer wieder zu. Wenn es keine Gesellschaft mehr gibt, welche die selbige aufrecht erhält, dann ist dieser Fortschritt wie einer der wandelnden Toten, die rastlos getrieben werden, aber am Ende doch einfach verwesen und zerfallen. Wenn sich die Toten erheben, bleibt der bestmögliche Ansatz auf Hilfe ganz sicher beim CDC. Er sei sehr dankbar, sagt Rick zu Jenner, dass dieser der kleinen Gruppe Einlass gewähre. „Der Tag wird kommen, an dem Sie es nicht mehr sind“, entgegnet Jenner.
TS-19 ist phänomenaler Brückenschlag zur ersten Episode, wenngleich weniger verstörend und eindringlich. Doch TS-19 bringt mit einem wortwörtlichen Knall diese viel zu kurz geratene erste Staffel zu einem Ende, wie man es erwartete, aber nicht erhoffte. Mit extrem geschickten und verdammt clever gesetzten Werbekampagnen hat sich THE WALKING DEAD schon von der ersten Folge an zu einem Phänomen mit großer Zuschauerpräsenz und treuer Fangemeinde erhoben. Und dieses Phänomen hat sich im Laufe der sechs Wochen nicht etwa relativiert, sondern gefestigt. Man hat von jener ersten Folge an erwartet, dass die Serie den Nagel auf den Kopf treffen würde. Der wahre Fan hatte allerdings gehofft, dass sie weniger spektakulär enden würde. Nur so ein bisschen weniger packend. Denn niemand, der die letzten sechs Wochen vor dem Fernseher zitterte, möchte nun elf Monate warten, bis man zurück in diese Welt entführt wird. Elf sehr lange Monate, die durch diese letzte Folge nicht einfacher gemacht werden, hat sie die Erwartungshaltung doch noch weiter nach oben geschraubt.
Dass Jenner, hervorragend und sehr eindringlich von Noah Emmerich verkörpert, der letzte Überlebende im CDC ist, wirft natürlich Fragen auf. Eine Frage, die ausgerechnet von Shane gestellt wird. „Was ist hier passiert?“, ist die Frage, welche die Folge bestimmt. Im Teaser haben wir erfahren, dass Shane während des Ausbruchs der Apokalypse tatsächlich versucht hat, den Koma-Patienten Rick aus dem Krankenhaus zu retten. Es schmerzt umso mehr, weil man als Zuschauer Shane stets schlechte Eigenschaften in Bezug auf Lori und seine Beziehung zu ihr unterstellt hat. Dass er in einer anderen Episode mit dem Gewehr auf Rick gezielt hat, wird mit einem Mal nicht akzeptabel, aber verständlich. Die Beziehung zu Lori wäre nicht auseinandergegangen, wäre Rick tatsächlich im Krankenhaus gestorben. Und dass Rick der Aufräum-Aktion des Militärs zum Opfer gefallen sein müsste, davon musste Shane einfach ausgehen.
Nun sitzt die kleine Gruppe im Schutz des undurchdringlichen Sicherheitsnetzes des CDC. Party-Laune in jener Institution, die dafür verantwortlich ist, dass Militärtrupps alle Krankenhäuser von vermeintlich Infizierten säuberten. Wobei das Wort säubern im Zusammenhang mit zerfetzten Schädeldecken etwas makaber wirken kann. Party-Laune in jener Institution, die dafür verantwortlich war, dass Shane seinen Kumpel und Kollegen Rick für tot halten musste. Die ausgelassene Stimmung bei etwas Essen, aber viel Wein, wird von Shanes Frage gekippt: „Was ist hier passiert?“
Nicht die Seuche hat das CDC geleert, sondern das Resultat der Seuche. Wissenschaftler, die mangels Erfolg bei der Bekämpfung der Epidemie einfach aufgaben, woanders Schutz suchten, sich das Leben nahmen oder den Verstand verloren. Jenner ist aus einem Versprechen heraus der letzte im CDC. Er kann den Neuankömmlingen anhand einer Computer-Tomographie zeigen, was im Kopf eines Infizierten passiert.
Allerdings fehlt ihm nach wie vor jede Erklärung dafür. Was also ist hier passiert? Man muss nicht lange rätseln, um darauf zu kommen, wen Doktor Jenner als Test-Subjekt Nummer 19 auf dem Tisch liegen hatte, als das CT aufgenommen und mit einem Kopfschuss beendet wurde.
In dieser verdrehten Weltordnung liegen Feiern und Frust eben ganz nah beieinander. Als die Gruppe ins CDC Einlass gewährt bekommt, meint Rick noch, dass sie hier sicher sind. Doch weiß man längst, dass dies nur zu einem gewissen Grad der Wirklichkeit entspricht. Denn es sind die Tücken des Fortschritts, die der Hoffnung immer und immer wieder zusetzen. Oder warum läuft das CDC noch, wo überall sonst die Welt zusammengebrochen ist? Und was passiert, wenn es nicht mehr laufen sollte? Fortschritt kann nur mit Aufwand betrieben werden. Welcher Aufwand ist notwendig, um das CDC am Leben zu erhalten? Einer, der nicht mehr geleistet werden kann.
Doch dem Verlangen der Gruppe, das CDC wieder verlassen zu wollen, muss widersprochen werden. Die Schleusen sind nun einmal versiegelt. In einem flammenden Appell muss Jenner seine nach Freiheit schreienden Gäste daran erinnern, wo sie sich befinden. „Ihr wisst, was dies für ein Ort ist. Wir beschützen die Öffentlichkeit vor wirklich üblem Zeug.“ Die Zombie-Apokalypse ist sicherlich das schlimmste Ereignis in jüngster Vergangenheit, aber man kann sich dennoch vorstellen, was man unter dem anderen ‚üblen Zeug‘ zu verstehen hat. Und man kann sich vorstellen, was mit dem ‚üblen Zeug‘ passiert, sollten die Sicherheitsmechanismen nicht mehr greifen. Zum Beispiel bei einem Stromausfall könnte übles Zeug entweichen, das überhaupt nicht gut für die Umwelt ist.
In diesem Fall würden Aerosolbomben den Sauerstoffgehalt der Luft auf bis zu 3000 Grad erhitzen. Die Luft würde brennen und kein sonst wie gearteter Virus entweichen können, geschweige denn, dass überhaupt etwas überleben würde. „Dort draußen wartet ein kurzes, brutales Leben mit einem qualvollen Tod.“ Jenner versucht, die Gruppe auf das Sterben vorzubereiten, es schmackhaft zu machen. Ein sehr schneller, schmerzloser Tod, wenn sich die Luft entzündet und das CDC in einem gigantischen Feuerball aufhört zu existieren. Das sind eben Sicherheitsmaßnahmen, die wirklich greifen, denn das Notstromaggregat läuft nur noch 30 Minuten.
In den nur scheinbar sicheren Wänden des CDC gönnt sich jeder der Neuankömmlinge erst einmal eine warme Dusche. Ein Privileg, das schon lange aufgeben werden musste. Damit schließt sich der Kreis zur ersten Episode, als Morgan und sein Sohn von Rick mit auf die Polizeistation genommen wurden, um dort den Luxus einer warmen Dusche zu genießen. Wenn die sozialen Strukturen auseinanderbrechen, dann bleibt eben als letzte Bastion der Normalität einfach nur eine staatliche Einrichtung.
Zumindest verfügen diese Einrichtungen über den größten Vorrat an Treibstoff für die Notstromaggregate. So einfach kann die Welt funktionieren. Und so einfach kann sie letztendlich dann auch auseinanderbrechen.
Die Macher haben, mit leicht zu verschmerzenden Ausnahmen, rundherum überzeugt. Mit dieser intensiv menschlichen und dramaturgisch packenden Folge haben sie die gesamte Staffel zu einer in sich geschlossenen Einheit verschmolzen. Sie haben offene Fragen beantwortet und dabei Wege für die düstere Zukunft aufgezeigt. Aber am wichtigsten war, ein funktionierendes Konzept stimmig zu Ende zu führen. Leider war Merle Dixon scheinbar doch nicht verantwortlich für die Zombie-Attacke aus Episode 4, reine Spekulation, die jetzt die Innereien auch nicht nach außen gestülpt hätte. Und dass Kameramann David Boyd doch noch so stark auf die verwackelten Bilder einer Schulterkamera setzte, die David Tattersall im Pilotfilm noch sehr erfolgreich zu vermeiden wusste, ist am Ende doch nur Kopf- und Haarspalterei.
„Ich bin sehr dankbar“, meint Rick noch am Anfang, und spricht damit im Namen seiner Gruppe. Es sind seine Leute geworden, seine Verantwortung.
Die Uniform zu tragen, ist kein eitles Gehabe, sondern es ist der letzte Versuch, die Normalität im Schatten der Widrigkeiten zu bewahren. Nicht die technischen Fortschritte, keine neuzeitliche Erfindungen, weder großer Spritvorrat noch Unmengen an Munition bewahren die letzten Menschen vor ihrem zu frühen Ende, sondern das Festhalten an Werten, die man in anderen Zeiten für überschätzt und sinnlos erachtet hatte. Ja, es wird der Tag kommen, an dem Rick nicht mehr dankbar sein wird. Denn diese 305 Minuten Exposition einer von Zombies verseuchten Welt hat dem Zuschauer schon zu oft gezeigt, dass wirklich alles möglich und niemand sicher ist. Rick Grimes wird irgendwann nicht mehr dankbar sein, weil seine Wertvorstellung es nicht zulassen kann, aufzugeben. Er wird daran verzweifeln, retten zu wollen, was vielleicht nicht zu retten ist. Diese 305 Minuten in sechs Episoden haben gezeigt, dass sich die Welt aber nur mit Menschen wie Deputy-Sheriff Rick Grimes weiterdrehen kann.
Darsteller: Andrew Lincoln, Jon Bernthal, Laurie Holden, Sarah Wayne Callies, Jeffrey DeMunn, Noah Emmerich, Steven Yeun, Melissa Suzanne McBride, Chandler Riggs, IroniE Singleton, Norman Reedus u.a.
Regie: Guy Ferland
Teleplay: Adam Fierro & Frank Darabont – nach den Comics von Robert Kirkman
Kamera: David Boyd
Originalmusik: Bear McCreary
Bildschnitt: Hunter M. Via
Produktionsdesign: Alex Hajdu
Special-Makeup-Effects & Consulting Producer: Grec Nicotero
USA 2010 – zirka 45 Minuten
AMC